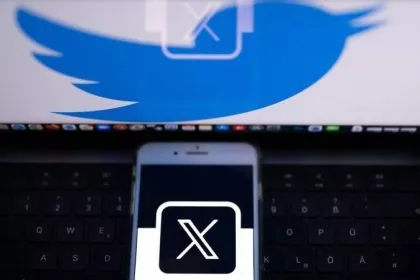„Digital Services Act"-Regeln bleiben unberührt
Nationale Zensur verletzt europäisches Recht: Deutschland muss Bußgeldverfahren gegen X stoppen
Deutschland muss seine Bußgeldverfahren gegen Social-Media-Betreiber nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz einstellen. Das hat nun auch Folgen für das geplante Verfahren gegen X. Der EuGH sieht nationale Zensurgesetze als binnenmarktwidrig an.

Der Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, steht im Visier von Vorwürfen unzureichender Beschwerdemanagements.
Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration
Deutschland wird bis auf Weiteres keine Bußgeldverfahren gegen Social-Media-Unternehmen nach dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) anstrengen können. Das ist die Konsequenz aus einem jüngst ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Wie das Bundesamt für Justiz gegenüber „t-online“ mitteilte, hat dies auch Auswirkungen auf das laufende Bußgeldverfahren gegen X. Ein solches hatte Deutschland im April dieses Jahres angestrengt.
Deutsches Vorgehen gegen X hätte ähnliches Ergebnis gehabt
In einem Vorabentscheidungsverfahren hat der EuGH in einer Klage dreier Onlinekonzerne gegen die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) verurteilt. Geklagt hatten Google, Facebook-Betreiber Meta und TikTok. Es ging dabei um die Anwendbarkeit von Bestimmungen des österreichischen Kommunikationsplattformen-Gesetzes (KoPl-G).
Der Tenor der Urteilsbegründung macht jedoch deutlich, dass die dort enthaltenen Ausführungen auch auf andere nationale Gesetzgebungsakte von EU-Mitgliedstaaten Anwendung finden. Entsprechend wäre auch beim deutschen Verfahren gegen X nach dem NetzDG mit einer ähnlichen Entscheidung zu rechnen gewesen.
Nun hat eine Sprecherin des Amtes gegenüber der Nachrichtenplattform bestätigt, dass drei laufende Bußgeldverfahren gegen Anbieter digitaler Dienste eingestellt werden. Gegen X hatte Deutschland erst im April ein solches angestrengt. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte damals von „hinreichenden Anhaltspunkten“ gesprochen, wonach X „gegen die gesetzliche Pflicht zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte verstoßen“ habe.
Irland wäre zur Kontrolle und zur Aufstellung von Regeln befugt
Jetzt hat der EuGH dieses Vorgehen gestoppt – nicht aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Redefreiheit, sondern hinsichtlich des Binnenmarktes. Das NetzDG und das KoPl-G verstoßen vielmehr gegen die E-Commerce-Richtlinie, sofern es um Anbieter mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten geht.
Anbietern von Onlinediensten soll die Teilnahme am Binnenmarkt demnach nicht durch einzelne Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten erschwert werden. Die europäischen Niederlassungen der meisten großen Social-Media-Konzerne sitzen in Irland. Entsprechend wäre auch dieses Land zuständig, um Regeln zu setzen und zu überwachen.
Damit jedoch, so heißt es aus dem Bundesamt, können „die Vorschriften des NetzDG nicht mehr gegenüber Anbietern mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsland durchgesetzt werden“. Das eingeleitete Vorgehen gegen X nun fallen zu lassen, sei die logische Konsequenz daraus. Auch wenn das Bundesamt nach wie vor auf dem Standpunkt stehe, dass der Konzern ein „systemisches Versagen im Beschwerdemanagement“ aufweise.
Von der Solidarität mit Michael Blume zum rekordverdächtigen Meldeaufkommen
Hinter dem Verfahren gegen X stehen die sogenannten #HateRangers. Das sind eine Einkäuferin und ein Behördenmitarbeiter aus dem Umfeld des umstrittenen baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume. Beide hatten eigenen Angaben zufolge ihre Freizeit geopfert, um „das Internet ein bisschen menschenfreundlicher zu machen“.
Seit September 2022 hatten „Bastelbro1“ und „sabi_ri“ mehr als 1.000 Meldungen und den Umgang von X mit diesen dokumentiert und an das Bundesjustizministerium weitergeleitet. Das war der Stand von April. Diese betrafen Beleidigungen und „Verleumdungen“ ebenso wie Bedrohungen, Gewaltaufrufe oder die Billigung des „russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine“.
Als Honorar gab es dafür lediglich ein Bild von Großpudeldame Nelly, die Blumes Rechtsanwalt Chan-Jo Jun dem „Bastelbro1“ eines Tages zur Aufmunterung geschickt habe.
Neues Dream-Team will Kampf gegen X nicht aufgeben
Beobachter sehen in der Intensität und Akribie des Einsatzes die größte Paaraktion gegen behaupteten Missbrauch der Redefreiheit seit dem jähen Zerfall des einstigen Dream-Teams aus Christoph Giesa und Liane Bednarz Mitte der 2010er-Jahre.
Minister Buschmann zeigte sich jedoch am Ende so beeindruckt von dem unermüdlichen Einsatz der #HateRangers, dass er die Einleitung eines Verfahrens verkündete. Unterdessen träumt „Bastelbro1“ davon, dass eines Tages ein Milliardär sagen könnte, „dass ich den Betrieb seiner Plattform in Deutschland zerstört habe“.
Dass die EU-weite Relevanz dem Vorgehen Grenzen setzen könnte, war „Bastelbro1“ jedoch klar. Deshalb setzen er und seine Mitstreiterin nun auf die EU-Kommission, der sie ihre umfangreiche Materialsammlung ebenfalls zugänglich gemacht hatten.
Diese geht mittlerweile auch ihrerseits gegen Twitter vor, wie der zuständige Digitalkommissar Thierry Breton vor wenigen Wochen ankündigte.
Schutz von Verbrauchern und Unternehmern – vor Redefreiheit und Innovation?
Ab dem 17. Februar 2024 wird der von der EU-Kommission geschaffene Digital Services Act (DSA) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten. Seit Ende August gilt er bereits für die sogenannten sehr großen Online-Plattformen und Online-Suchmaschinen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in der EU. Dies entspricht zehn Prozent der EU-Bevölkerung.
Die Kommission veranlasste die Verordnung im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz der EU für den digitalen Binnenmarkt. Damit gilt sie unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten, ohne dass es einer weiteren nationalen Umsetzung durch die Mitgliedstaaten bedarf.
Vordergründig soll der DSA europäische Verbraucher und ihre Grundrechte im digitalen Raum schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen sicherstellen. Kritiker hingegen werfen der EU vor, dadurch vorwiegend die Redefreiheit einzuschränken und Europa durch bürokratische Vorgaben und Schikanen von digitaler Innovation abzuschneiden. Meta hatte sogar bereits damit gedroht, Facebook und andere Dienste aus der EU abzuziehen.
test test test
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.