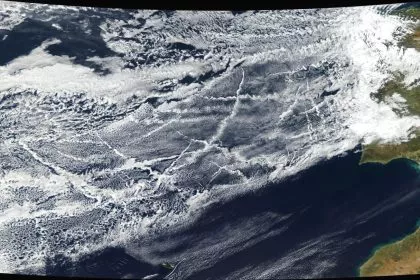Studie: Klimamodelle ignorieren Vulkane
Vulkane werden in Klimaprojektionen deutlich unterschätzt, erklären Forscher der Cambridge-Universität. Das betreffe sowohl Emissionen als auch deren Auswirkungen – einschließlich ihrer kühlenden Effekte.

Der Ätna spuckt bei einem Ausbruch Ende Mai 2022 Lava und Asche.
Foto: Salvatore Allegra/AP/dpa
Wo und wann ein Vulkan ausbricht, kann der Mensch nicht beeinflussen, doch Vulkane spielen eine wichtige Rolle im globalen Klimasystem. Wenn Vulkane ausbrechen, können sie Schwefelgase in die obere Atmosphäre ausstoßen, die winzige Partikel, sogenannte Aerosole, bilden, die das Sonnenlicht zurück ins All reflektieren. Bei sehr großen Ausbrüchen, wie dem des Mount Pinatubo im Jahr 1991, ist die Menge der vulkanischen Aerosole so groß, dass sie im Alleingang einen Rückgang der globalen Temperaturen bewirken.
Dieser kühlende Effekt werde jedoch von den meisten Klimamodellen „wahrscheinlich um den Faktor zwei und möglicherweise sogar um den Faktor vier unterschätzt“. Zu diesem Schluss kommen Forscher um Physikprofessorin Anja Schmidt von der Ludwig-Maximilians-Universität München und der University of Cambridge. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten sie Mitte Juni in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“.
Vulkane beeinflussen Temperatur, Meeresspiegel und Meereis
„Verglichen mit den [Emissionen] der Menschen ist der Einfluss von Vulkanen auf das globale Klima relativ gering“, erklärte Erstautorin May Chim, Doktorandin im Fachgebiet Chemie an der Universität Cambridge. Dennoch dürfe man Vulkane nicht einfach ignorieren.
So ginge beispielsweise das IPCC in seinem Sechsten Sachstandsbericht davon aus, dass die explosive vulkanische Aktivität in den Jahren 2015 bis 2100 auf demselben Niveau liegen wird wie im Zeitraum 1850 bis 2014. Gleichzeitig übersieht es jedoch die Auswirkungen von Eruptionen kleinerer Größenordnung. Denn, so Chim, „diese Prognosen stützen sich meist auf Eiskerne, um abzuschätzen, wie Vulkane das Klima beeinflussen könnten. Aber kleinere Eruptionen sind zu klein, um in Eiskernaufzeichnungen erfasst zu werden.“
Um „die Lücke zu schließen und Eruptionen aller Größenordnungen zu berücksichtigen“, griffen die Forscher daher auf Satellitendaten zurück. Aus der Kombination der Daten erstellten Prof. Schmidt und Kollegen von den britischen Universitäten Cambridge, Durham und Exeter, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie dem britischen Wetterdienst verschiedene Szenarien für künftige vulkanische Aktivitäten.
Dabei stellten sie fest, dass die vulkanischen Schwefeldioxidemissionen „im Zeitraum 2015 bis 2100 mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit den Wert von 1850 bis 2014 übersteigen.“
Anschließende Vergleiche mit klassischen Klimamodellen zeigten, dass letztere die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf das Klima, einschließlich der globalen Oberflächentemperatur, des Meeresspiegels und der Meereisausdehnung, unterschätzen. Als Grund nennen die Forscher, dass die bisherigen Prognosen „das plausible künftige Ausmaß der vulkanischen Aktivität weitgehend unterschätzen“.
Kleine Eruptionen erzeugen genauso viele Aerosole wie Große
Während sich große Ausbrüche nur wenige Male pro Jahrhundert ereignen, finden die meisten kleineren Eruptionen alle ein bis zwei Jahre statt. Das führe dazu, dass kleinerer Ausbrüche für die Hälfte aller Schwefelgase verantwortlich sind, die von Vulkanen in die obere Atmosphäre abgegeben werden.
Entsprechend fanden die Forscher heraus, dass bereits bei mittlerer Aktivität der sogenannte vulkanische Antrieb – der kühlende Effekt der Aerosole – in den Klimaprojektionen um bis zu 50 Prozent unterschätzt wird. Das sei zum großen Teil auf die Wirkung von Eruptionen kleinerer Größe zurückzuführen.
„Der vulkanische Antrieb wird nicht nur unterschätzt. Ausbrüche kleinerer Größenordnungen sind für die Hälfte des gesamten vulkanischen Antriebs verantwortlich. Diese kleinen Eruptionen haben einzeln vielleicht keine messbare Wirkung, aber in ihrer Gesamtheit sind sie von großer Bedeutung“, erklärte Chim. Weiter sagte sie:
„Ich war überrascht zu sehen, wie wichtig diese kleinen Eruptionen sind. – Wir wussten, dass sie eine Wirkung haben, aber wir wussten nicht, dass sie so groß ist.“
Wirkung nur von kurzer Dauer
Obwohl die kühlende Wirkung von Vulkanen in Klimaprojektionen unterschätzt werde, betonen die Forscher, dass sie nicht mit den vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen vergleichbar ist.
„Vulkanische Aerosole in der oberen Atmosphäre bleiben in der Regel ein oder zwei Jahre in der Atmosphäre, während Kohlendioxid viel, viel länger in der Atmosphäre verbleibt“, so Chim. Wie lange „viel, viel länger“ ist, sagte sie nicht. Stattdessen ergänzte sie:
„Selbst, wenn wir eine Periode außergewöhnlich hoher vulkanischer Aktivität hätten, würden unsere Simulationen zeigen, dass dies nicht ausreichen würde, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Es ist wie eine vorbeiziehende Wolke an einem heißen, sonnigen Tag: Die kühlende Wirkung ist nur vorübergehend.“
Unerwähnt blieb damit, dass die Natur ständig eine beträchtliche Menge CO₂ aus der Atmosphäre entfernt – und dass diese Entnahme umso größer ist, je mehr Kohlenstoffdioxid in der Luft ist.
Die Forschungsarbeiten wurden teilweise von der Croucher Foundation und dem Cambridge Commonwealth, dem European & International Trust, der Europäischen Union und dem Natural Environment Research Council unterstützt.
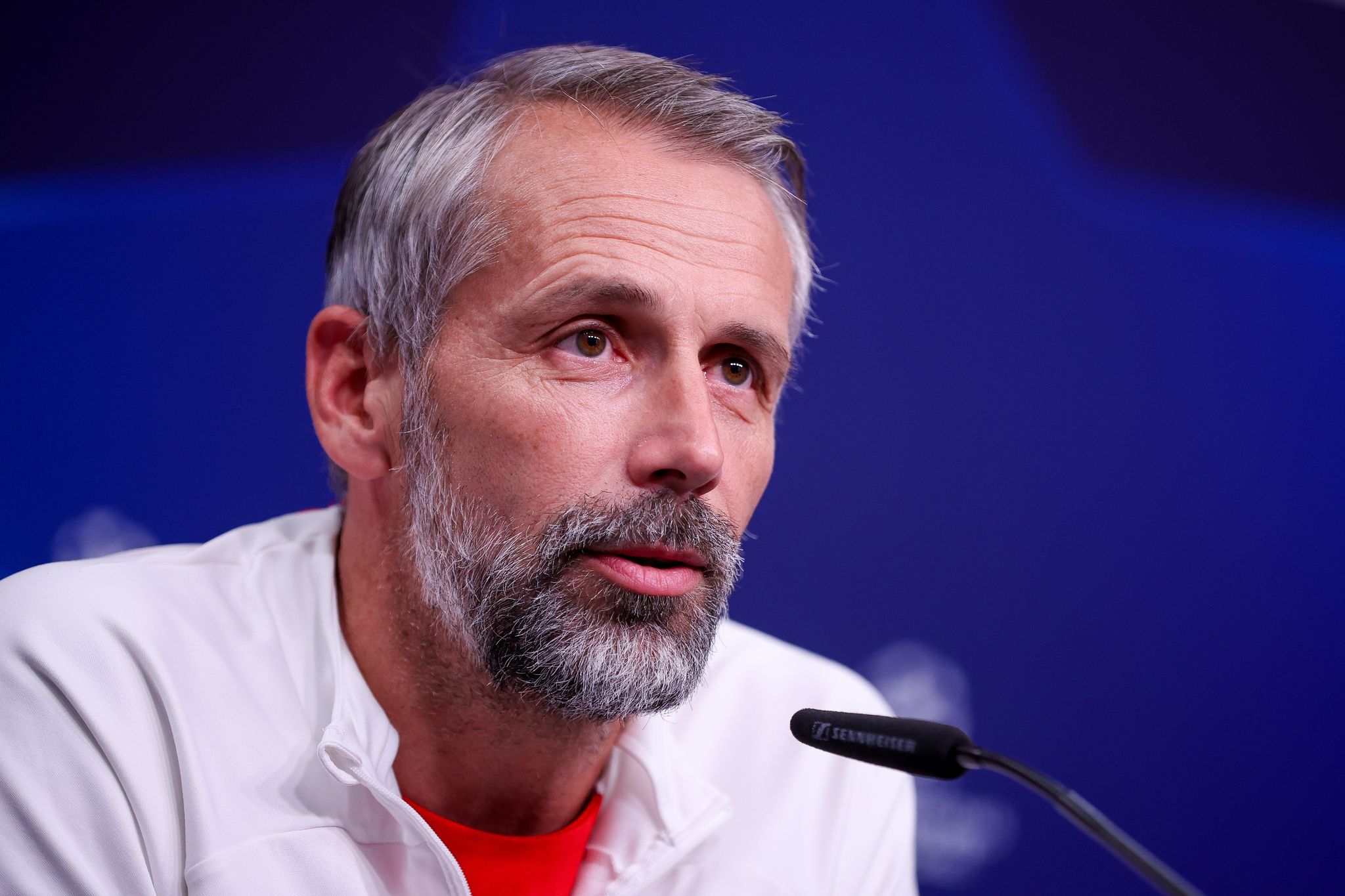
test test test 3333 test test test test test test
Aktuelle Artikel des Autors
14. Januar 2025
Infraschall aus Sicht eines Physikers: Die unhörbare Gefahr?
10. Januar 2025
Von der Steinzeit bis zum Flug ins Weltall
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.