Forscher könnten aus Hühnern bald Frösche, Fische oder Chamäleons machen
Dass Menschen – sinnbildlich – aus einer Mücke einen Elefanten machen können, ist hinlänglich bekannt. Weitreichender sind dagegen die Entwicklungen von Harvard-Forschern: Sie konnten Hühner im frühen Entwicklungsstadium zu Fröschen, Fischen oder Chamäleons „umformen“.

Von der Mücke zum Elefanten war gestern. Jetzt ist das Huhn an der Reihe.
Foto: iStock
Was ist, wenn der Mensch in den Lauf der Natur eingreift und bestimmte Prozesse in ihrem Ablauf verändert? Diese Frage stellen sich Forscher weltweit – sei es für die Eindämmung von Krankheiten oder die Umleitung von Lavaströmen.
Doch was passiert, wenn der Mensch in den ersten Prozess eines Lebewesens, der Embryonalentwicklung, eingreift? Kann die Natur so „umprogrammiert“ werden, dass aus Hühnern andere Tiere wie etwa Frösche oder Fische werden? Was nach Science-Fiction klingt, könnten US-Wissenschaftler bald Realität werden lassen, indem sie die sogenannte Gastrulation, eine der wichtigsten Phasen der frühen Embryonalentwicklung, verändern.
Den Lauf der Natur …
Bevor die Gastrulation einsetzt, besteht ein Wirbeltierembryo aus einfachen zweidimensionalen Zellblättern. Im Rahmen der Gastrulation wird das Grundgerüst schließlich ausgebaut, sodass verschiedene Zelltypen, die grundlegenden Achsen des Körpers und einige Vorstufen der Organe entstehen.
Mit dem Ende dieses Prozesses besitzen Amnioten, zu denen Hühner und Menschen zählen, eine einfache Struktur, die den Vorläufer des Gehirns und der Haut beinhaltet. Wesentlich weiter sind zu diesem Zeitpunkt dagegen die Embryos von Fischen und Amphibien, die mit einem kugelförmigen „Urmund“ bereits den Ansatz des Darms haben.
Die Gastrulation gilt deshalb als meisterhafte Selbstorganisation, die einer ballettartig koordinierten Bewegung von Hunderten bis Zehntausenden Zellen gleichkommt. Doch nicht alle Funktionsweisen und Mechanismen sind den Wissenschaftlern derzeit bekannt.
Um diese Wissenslücke zu schließen, setzten sich Wissenschaftler der Harvard-Universität (USA), der University of California San Diego (USA) und der University of Dundee (Großbritannien) daran, die bei der Entwicklung eines Hühnerembryos entstehenden Muster zu reproduzieren und vorherzusagen.
… durch zwei Parameter verändert
In ihrem Experiment erkannten die Forscher zugleich, dass bereits kleine Veränderungen der Zellparameter und des Zellverhaltens einen bedeutenden Einfluss auf die daraus entstehenden Gastrulationsmuster haben können.
In enger Zusammenarbeit mit Experimentalphysikern entwickelten die Forscher ein theoretisches und computergestütztes Modell, das die Bewegung von Zellschichten in Kükenembryonen während der Gastrulation nachbilden konnte. Das Team identifizierte dann zwei Parameter, die während der Gastrulation verändert werden können. Ein Parameter hängt mit der anfänglichen Verteilung der Zellen in einem Embryo zusammen, während der andere mit dem Verhalten der Zellen verbunden ist.
„Als wir diese beiden Parameter in dem Hühner-Gastrulationsmodell änderten, zeigte es bemerkenswerterweise Gastrulationsmuster, wie sie auch bei anderen Spezies zu beobachten sind“, so Mattia Serra, Erstautor der Studie und Assistenzprofessor für Physik an der University of California San Diego.
Früher Hühner, jetzt Frösche und Co
In Übereinstimmung mit den Berechnungsergebnissen zeigen Experimente, dass die Störung der gleichen Parameter in vivo in einem Kükenembryo dazu führte, dass das Küken einen scheibenförmigen Urmund bildet, wie er bei Fröschen vorkommt. Andererseits könne es auch eine einfache, ringförmige Struktur bilden, wie sie Fische besitzen oder gar eine kanalähnliche Struktur wie bei Chamäleons.
„Unsere Arbeit deutet darauf hin, dass die allgemeinen biophysikalischen Prinzipien, die den aktiven selbstorganisierten Strömungen und Kräften während der Embryogenese zugrunde liegen, Entwicklungsprozesse und Variationen bei verschiedenen Wirbeltierarten erklären können“, so Professor Mahadevan von der Harvard Universität.
Als Nächstes möchten Mahadevan und seine Kollegen verstehen, was passiert, wenn der Embryo beginnt, komplexere Formen von Organen und schließlich ganze Organismen zu bilden. „Mit unserem Wissen über Entwicklungsprozesse auf molekularer und zellulärer Ebene hoffen wir schließlich, einen Rahmen dafür zu schaffen, wie sich Zellen zu Geweben und Gewebe zu Organen formen, um die Morphogenese besser zu verstehen“, so Mahadevan.
Die Studie erschien am 6. Dezember 2023 in der Fachzeitschrift „Science Advances“.
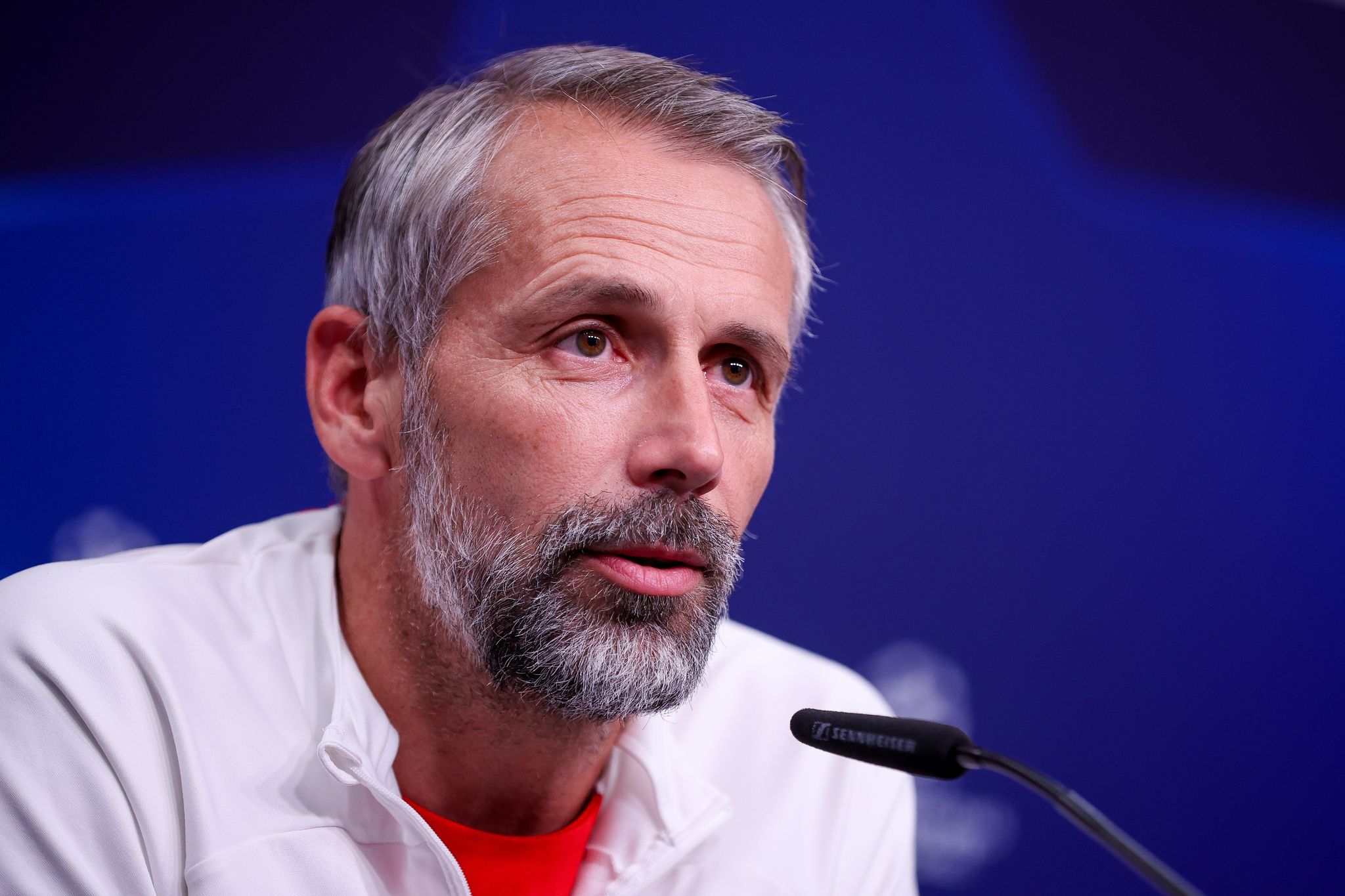
test test test 3333 test test test test test test
Aktuelle Artikel des Autors
14. Januar 2025
Infraschall aus Sicht eines Physikers: Die unhörbare Gefahr?
10. Januar 2025
Von der Steinzeit bis zum Flug ins Weltall
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.









