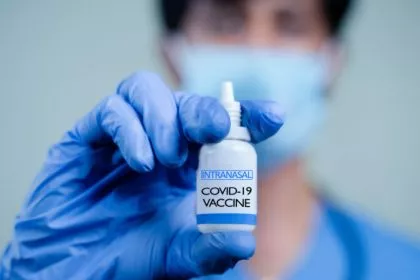Studie: Möglicher Mechanismus für Herzmuskelentzündung nach mRNA-Impfungen
Das Risiko für eine Herzmuskelentzündung nach einer COVID-19-Impfung ist mittlerweile bekannt und in den Fachinformationen der mRNA-Impfstoffe gelistet. Welche Mechanismen jedoch für diese Nebenwirkung vor allem bei jungen Menschen verantwortlich sind, ist bisher wissenschaftlich nicht geklärt. Nun identifizierten Forscher einen Biomarker, der auf eine Fehlreaktion des Immunsystems hinweist.

Forscher fanden heraus dass Antikörper gegen den Interleukin-1-Rezeptor ein Biomarker für Herzmuskelentzündung nach COVID-19 Impfung sein kann. Quelle: istock
Laut aktualisierten Herstellerinformationen der EMA zu den COVID-Impfstoffen von Pfizer [1] und Moderna [2] liegt das allgemeine Risiko für Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) nach einer mRNA Impfung bei 1 zu 10.000. Bisherige Studien [3,4] zeigen, dass junge Männer besonders häufig davon betroffen sind.
Möglicher Übeltäter: Antikörper gegen Interleukin-1-Rezeptorantagonist
„Gerade bezüglich Entzündungen an Herzbeutel, Herzmuskel sowie Gefäßen wissen wir bereits um die zentrale Bedeutung von Interleukin-1. Unser Immunsystem reguliert sich jedoch normalerweise selbst und gerade hochpotente Interleukine haben natürliche Gegenspieler“, sagt Dr. Christoph Kessel vom Universitätsklinikum Münster und Co-Autor der Studie.
Fehlreaktion des Immunsystems
Fragen nach Auslöser und weiteren Biomarkern noch offen
Quellen und Literatur
Aktuelle Artikel des Autors
2. November 2023
Optimierte Nanopartikel ermöglichen mRNA-Impfungen zum Einatmen
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.