Neben Entwicklung der E-Autos
60-Milliarden-Euro-Investition: Volkswagen setzt weiterhin auf Verbrenner
Neben der Entwicklung der Elektromobilität will Volkswagen auch weiterhin in Verbrenner investieren. Der Konzern stellt vor, zu welchen Anteilen die beiden Antriebsarten gefördert werden.
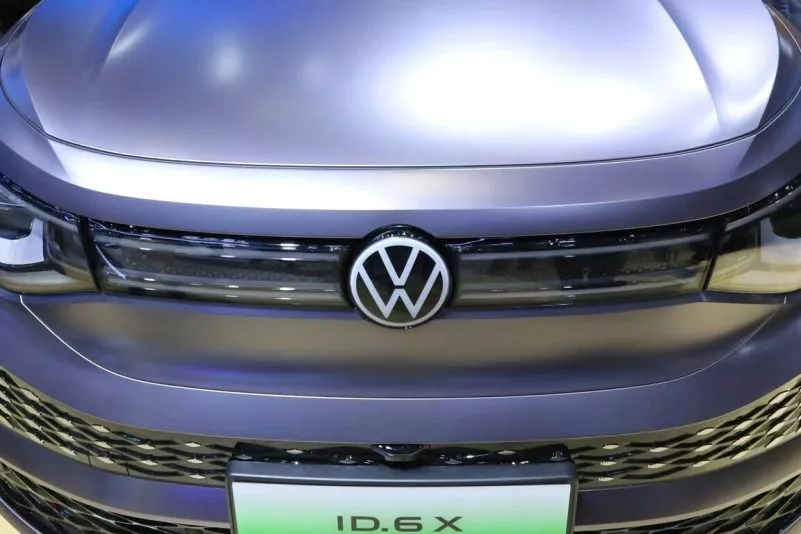
Volkswagen richtet sich wieder neu aus.
Foto: Fang Zhe/XinHua/dpa
Nach Mercedes und BMW passt jetzt auch der Volkswagen-Konzern seine Strategie an. Mit dem Ende der staatlichen Förderung von E-Neuwagen brach die Nachfrage nach E-Autos ein. Stattdessen bevorzugen die Kunden derzeit vermehrt die verfügbaren Verbrenner- und Hybridmodelle.
Aufgrund dieser Entwicklung hat die Automarke mit dem mit Abstand größten Pkw-Absatz in Deutschland nun ihre Elektrostrategie überarbeitet. Im Vorjahr stellte sich VW noch darauf ein, dass in Europa bis 2030 rund 80 Prozent aller Neuwagen batteriebetrieben sein werden. Zu diesem Kurs sollte auch das von der EU-Kommission beschlossene Verbrennerverbot bis 2035 für Neuwagen beitragen. Allerdings gibt es inzwischen Zweifel an der Umsetzung dieses Beschlusses.
Neuer Investitionsplan bei VW
Konzernfinanzchef Arno Antlitz ist zuständig für die Entwicklungsetats. Kürzlich erklärte er in München, wie viel der Konzern in den kommenden Jahren in welchen Bereichen investieren wolle. Bis 2028 ist ein Investitionsvolumen von 180 Milliarden Euro vorgesehen. Davon sollen rund 120 Milliarden Euro in die Elektrosparte und die Digitalisierung der Produktpalette fließen, wie „auto motor und sport“ berichtete.
Konzernchef Oliver Blume teilte vor Kurzem mit, dass das Unternehmen weiterhin „klar“ auf die Elektromobilität setzen will.
Die Entwicklung der Verbrennerfahrzeuge soll dennoch nicht zu kurz kommen. Das restliche Drittel – also rund 60 Milliarden Euro – will Volkswagen investieren, um „Verbrennerautos in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten.“
Diese Entscheidung könnte als Kehrtwende betrachtet werden. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat der Konzern verstärkt in die Elektromobilität investiert. Hier ist vor allem der modulare Elektrobaukasten (MEB) zu nennen. Auf dessen Basis hat VW verschiedene Modelle wie den VW ID.3, den Audi Q5 und den Škoda Enyaq gebaut.
Obwohl VW rund zwei Drittel seines Entwicklungsbudgets in künftige Elektrofahrzeuge steckt, ist das kein Garant für einen dauerhaften Absatzanstieg.
25.000-Euro-E-Auto wird doch teurer
Von Januar bis einschließlich Mai dieses Jahres verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt 1.174.312 neu zugelassene Pkw, wie „Merkur.de“ berichtete. Im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von rund fünf Prozent. Die Elektrofahrzeuge verzeichneten jedoch mit 140.713 Einheiten einen Rückgang um knapp 16 Prozent.
Ein Grund, warum die Nachfrage nach Stromern zurückging, ist der vergleichsweise hohe Kaufpreis.
Daher hat Volkswagen bereits angekündigt, den Kunden ein erstes Elektromodell als „25.000-Euro-Auto“ anzubieten. Das soll nun allerdings mehr als 25.000 Euro kosten. „Der Preis für den CUPRA Raval wird eher zwischen 25.000 und 30.000 Euro liegen“, sagte Wayne Griffiths dem „Spiegel“.
Der Chef der beiden spanischen Volkswagen-Marken Seat und CUPRA ist für die Entwicklung von Karosserie und Innenausstattung von Volkswagens zukünftig günstigsten Elektromodellen verantwortlich. Sein CUPRA Raval soll als erstes Modell aus dieser Familie Ende 2025 auf den Markt kommen, gefolgt von Modellen der Marken VW und Skoda.
Ende Mai hatte Volkswagen zudem angekündigt, bis 2027 eine Modellfamilie im Bereich von 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Griffiths machte zumindest Hoffnung, dass Seat, das bisher noch kein reines Elektroauto hat, auch ein Modell aus dieser Familie entwickeln wird. „Ein elektrischer Seat wird kommen, wenn wir uns das leisten können“, sagte Griffiths. „Viele Seat-Modelle kosten um die 20.000 Euro, teils darunter. So ein Preis ist bei Elektroautos bisher nicht darstellbar. Aber die Zeit wird kommen.“
Volkswagen ist einer der führenden Automobilkonzerne weltweit. Neben Audi und Skoda besitzt VW auch die Marken Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, Navistar und Seat.
(Mit Material von dts)
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.










