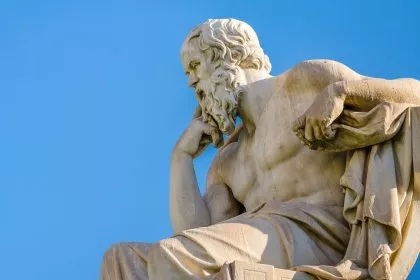Kein Forschungsgebiet unserer Zeit wurde so schnell vorangetrieben wie die Erforschung des neuartigen Coronavirus und die Suche nach geeigneten Wirk- und Impfstoffen. Dabei rückt die Debatte um einen möglichen Impfstoff besonders in den Fokus, denn viele Virologen sprachen wiederholt davon, dass die Corona-Pandemie erst dann vorbei sei, wenn es einen Impfstoff gäbe.
Die Forschungs- und Pharmaindustrie hat diesen Aufruf ernst genommen und in Rekordzeit wurden 124 Impfstoffkandidaten bei der Weltgesundheitsorganisation gemeldet, die sich nun in unterschiedlichen Testphasen befinden. Offiziell weiß man von insgesamt 180 verschiedenen Ansätzen einen Impfstoff zu entwickeln.
Am 11. August 2020 kam dann die überraschende Meldung, dass in Russland der erste Impfstoff „Sputnik V“ gegen SARS-CoV-2 registriert wurde, der unter Notfallregeln während der Covid-19-Pandemie genutzt werden kann, um die russische Bevölkerung zu impfen. Dies geschah nur knapp acht Monate nach dem Bekanntwerden des neuartigen Virus.
Um die Entwicklung in den klinischen Phasen und die Unterschiede zu anderen Impfstoffen besser verstehen zu können, geben wir einen Überblick zu den üblichen Testverfahren und das herkömmliche Prozedere, bevor ein Impfstoff normalerweise zugelassen werden darf.
Klinische Testverfahren bei herkömmlichen Impfstoffen
Nachdem sich in der sogenannten Grundlagenforschung passende Kandidaten herauskristallisieren, kann man mit diesen in die ersten präklinischen Tests gehen.
Unter Präklinischen Tests versteht man, dass man einen ausgewählten Impfstoffkandidat an Zellkulturen und später in Tierversuchen prüft. Schafft es der Kandidat in dieser Phase, seine Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu beweisen, geht es weiter in die klinischen Tests der Phase I.
- In Phase I wird erstmals am Menschen, jedoch an einer kleinen Gruppe gesunder Freiwilliger getestet. Dabei wird hauptsächlich auf Verträglichkeit sowie Aufnahme, Verteilung, Umwandlung und Ausscheidung der Substanz geachtet. Oft erprobt man dabei verschiedene Dosen, um eine geeignete Dosierung für Phase II zu finden.
Phase II darf dann starten, wenn keine relevanten Nebenwirkungen und Sicherheitsfragen auftreten und die vorläufigen Nachweise darauf hindeuten, dass eine Wirksamkeit besteht. Meist werden in dieser Phase zehn bis 30 Personen getestet.
- In Phase II testet man, meist in enger Zusammenarbeit mit Kliniken, erstmals die Wirksamkeit. Im Falle eines Impfstoffes heißt dies, dass er in der Lage sein muss, die Erkrankung zu verhindern oder die Symptome im Falle einer Erkrankung deutlich abzuschwächen.
Während dieser Phase muss es Kontrollgruppen geben und zur guten klinischen Praxis gehören doppelt verblindete Placebostudien. Dies bedeutet, dass weder die Probanden noch die Ärzte über den gesamten Vorgang hinweg bis zur Auswertung wissen, wer den echten Wirkstoffkandidaten und wer das Placebo (Anmerk. der Red.: äußerlich vom Impfstoff nicht zu unterscheidendes Präparat, jedoch ohne Wirkstoff) erhält. Damit will man verhindern, dass es zu einer Verzerrung der Ergebnisinterpretation kommt. In dieser Phase werden üblicherweise insgesamt 50 bis 500 Personen getestet.
Sind die Ergebnisse vielversprechend und der Nutzen wird größer als das Risiko bewertet, kann der Impfstoff in Phase III übergehen.
- In Phase III wird mit der in Phase I und II herausgefundenen Dosierung erstmals an einer größeren Gruppe getestet. Hier müssen mindestens 1000 Freiwillige den Impfstoff erhalten. Dabei wird die Zuverlässigkeit des Schutzes überprüft und mögliche Nebenwirkungen können durch die größere Anzahl an Menschen besser abgeschätzt werden. Oft passiert dies auch in Etappen, mit einer geregelten und langfristigen Überwachung.
In Hinblick auf die Sicherheit ist diese Phase besonders wichtig, weshalb sie üblicherweise vier bis sechs Jahre dauert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Langzeitnebenwirkungen eben nicht sofort sichtbar sind.
Zeigt Phase III die gewünschten Ergebnisse, darf der Impfstoff zugelassen werden. Somit dauert in einem
normalen Verfahren das vollständige Prozedere zwischen acht und 17 Jahren.
Die Klinischen Phasen für einen Corona-Impfstoff
In kritischen Situationen gibt es die Möglichkeit einer schnelleren und vereinfachten Zulassung. Diese strebte man in der Vergangenheit beispielsweise für einen Impfstoff gegen MERS oder SARS an. Da in diesen Fällen die Krankheiten aber rasch verschwanden, wurden die Forschungen großteils eingestellt und es kam zu keiner offiziellen Zulassung. Allerdings haben mehrere Forschungsgruppen und Unternehmen angegeben, für einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 auf diesen Daten aufzubauen.
Für gewöhnlich beträgt alleine die Zeit von der Grundlagenforschung bis zur präklinischen Phase eines Impfstoffes normalerweise zwei bis fünf Jahre. Seit die Welt auf das neuartige Coronavirus aufmerksam wurde – im Dezember 2019 – bis heute, sind bereits 124 Impfstoffkandidaten in der präklinischen Testphase.
Allerdings gibt es auch Impfstoffkandidaten, die innerhalb der acht Monate schon wesentlich weiter sind. Zehn Wirkstoffe befinden sich laut dem
Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) aktuell in Phase I, drei Wirkstoffe in Phase II und fünf Wirkstoffe werden bereits im größeren Ausmaß in Phase III getestet.
Seit 11. August gibt es mit dem russischen Wirkstoff „
Sputnik V“ die erste offizielle Registrierung eines Impfstoffs gegen COVID-19, der damit großflächig eingesetzt werden kann. Dass dies allerdings nicht unter Einhaltung der herkömmlichen klinischen Testphasen geschehen konnte, ergibt sich von selbst.
Die klinischen Phasen für den russischen Impfstoff „Sputnik V“
Die Meldung der schnellen Registrierung und der geplante Einsatz eines Impfstoffes des Moskauer Gamaleya-Instituts in Russland kam für viele überraschend.
Präsident Putin verkündete bei der
Pressemitteilung über die Impfung: „Ich weiß, dass sie wirksam ist, dass sie eine dauerhafte Immunität gibt.“ Auch eine seiner Töchter sei bereits geimpft und habe lediglich eine „leicht erhöhte Temperatur gehabt.“
Die Zulassung erfolgte
laut Professor Denis Logunov, stellvertretender Direktor des Zentrums für wissenschaftliche Arbeit des Gamaleya-Zentrums, vollkommen übereinstimmend mit den in Russland geltenden Gesetzen.
Dort ist es nämlich erlaubt Phase I und II zusammenzufassen. Insgesamt wurde der Impfstoff laut Professor Logunov bisher an 76 Menschen getestet.
Er selbst und sein Team haben sich ebenfalls, bereits mit einem Prototyp vor der Zulassung, geimpft. Laut eigenen Angaben geschah dies als „Selbstschutz“, da sie direkt mit dem Virus und infektiösem Material arbeiten.
Phase III erfolgt nun nach der Registrierung, wofür Tests an ungefähr 40.000 Menschen geplant sind. Bisher sind die wissenschaftlichen Daten der Untersuchungen an den 76 Menschen aus Phase I/II nicht veröffentlicht. Dies ruft unter vielen Fachleuten Sorge hervor.
„Dass die Russen solche Maßnahmen und Schritte überspringen, beunruhigt unsere Gemeinschaft von Impfwissenschaftlern“,
sagt Peter Hotez vom Baylor College of Medicine in Houston (Texas) dem Fachjournal
Nature in einer Stellungnahme
.Die Veröffentlichung solle aber, laut Professor Logunov, innerhalb eines Monats in einem ausgewählten wissenschaftlichen Journal erfolgen. Bis dahin bleiben offene Fragen. Zum Beispiel wie man die „dauerhafte Immunität“, die Präsident Putin ansprach, in so kurzer Zeit überprüfte.
Die verwendete Technologie sei gut erforscht und Professor Logunov verteidigt die Registrierung. Er sagt, dass sein Team hart arbeite, um ein Produkt von hoher Qualität zu produzieren. Dabei beruft er sich auch auf seine eigenen Erfahrungen, die er in mehrjähriger Forschung für einen Impfstoff gegen MERS, gemacht habe.
“Wir haben eine große Verantwortung. Es ist unsere höchste Priorität, bei der Produktion einer großen Anzahl des Wirkstoffes nichts an Qualität zu verlieren, damit die Menschen einen guten Impfstoff bekommen“,
sagt Professor Logunov in einem Interview.
Auf eine Frage, welche die Unterschiede zwischen den internationalen Richtlinien für klinische Tests und dem durchgeführten Verfahren ansprach, sagte Professor Logunov, dass alles genau dem russischen „Federal Law No. 61“ entspreche. Er fügt hinzu:
“Wenn jemandem die russischen Gesetze nicht gefallen, ist das nicht unser Problem.“
Die Massenproduktion von Sputnik V soll bereits im September starten und ab 1. Januar für die Bevölkerung verfügbar sein. Medizinisches Personal oder Lehrer sollen zuerst eine Impfung erhalten, dann die übrige Bevölkerung. Auch erste Bestellungen von anderen Ländern sollen bereits eingetroffen sein.
Wie die Impfung wirkt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die stark verkürzten klinischen Phasen sind jedoch ein wesentlicher Unterschied zu allen Impfstoffen, die man bisher verwendet. Dieser Unterschied wird auch bei den folgenden Zulassungen anderer Impfstoffe gegen COVID-19 erhalten bleiben.
Vorschau auf Teil 2
Dies ist aber nicht die einzige Unterscheidung zu bisherigen Impfungen. Auch die eingesetzten Technologien können nicht mit denen herkömmlicher breit angewendeten Impfstoffe verglichen werden. Denn erstmals kommen genetische Impfstoffe zum Einsatz.
Bei Sputnik V handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff, der im menschlichen Körper das bereits viel diskutierte „
Spike-Protein“ des Virus nachbildet. Auch RNA und DNA-Impfstoffe werden für COVID-19 erforscht. Was dies bedeutet, was man bisher darüber weiß und warum diese als umstritten gelten, ist Thema von
Was diese Impfung von allen bisherigen unterscheidet-Teil 2: „Genetische Impfstoffe – Die neuen Technologien“ .
Über die Autorin: Mag. pharm. Christina Winter hat Pharmazie studiert und arbeitet zurzeit als Doktorandin im Bereich der Galenik an der Entwicklung von Arzneimitteln gegen verschiedene Entzündungen. Sie schreibt regelmäßig Berichte zum Thema Gesundheit, aktuelle Forschung und traditionelle Medizin für Vision Times.