Rechnen ohne Großhirnrinde
Buntbarsche und Stachelrochen können addieren und subtrahieren
Mit diesem Ergebnis haben die Forscher nicht gerechnet: Fische können rechnen – zumindest plus und minus eins. Wie Forscher der Uni Bonn mitteilten, lernten Stachelrochen langsamer als Buntbarsche, erzielten in der anschließenden Leistungskontrolle aber mehr Punkte.

Stachelrochen können besser rechnen als Malawi-Buntbarsche. Wozu sie es brauchen, wissen die Forscher nicht. (Symbolbild)
Foto: iStock
Blaue Malawibuntbarsche (Maylandia zebra) und Stachelrochen (Potamotrygon motoro) können eins zu Zahlen bis fünf addieren beziehungsweise subtrahieren. Das teilten Forscher um die Zoologin Prof. Dr. Vera Schlüssel von der Universität Bonn am Freitag mit. Dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt, belegt die in “Scientific Reports” veröffentlichte Studie. Sie erschien bereits einen Tag vorher.
Die Ergebnisse zeigen, dass die numerischen Fähigkeiten von Fischen mit denen anderer Wirbeltiere und Wirbelloser gleichzusetzen sind, so die Autoren. Wozu die Tiere ihre mathematischen Fähigkeiten benötigen, sei jedoch nicht bekannt.
Wie fragt man einen Fisch?
Die Bonner Zoologin Vera Schlüssel ließ beide Arten in ihrer Studie einfache Additionen und Subtraktionen vornehmen. “Dabei mussten sie einen Ausgangswert um eins erhöhen oder vermindern”, erklärte Schlüssel. Dazu nutzten sie und ihr Team bereits bei anderen Tierarten erprobte Methoden zum Test der mathematischen Fähigkeiten.
„Doch wie fragt man einen Buntbarsch nach dem Ergebnis von 2 + 1 oder 5 – 1?“, fragen die Forscher in einer Mitteilung der Universität. Sie zeigten den Fischen eine Ansammlung geometrischer Formen – zum Beispiel vier Quadrate. Waren diese Objekte blau gefärbt, bedeutete das „addiere eins“. Gelb hieß dagegen „subtrahiere eins“.
Danach wurde die Aufgabe ausgeblendet. Stattdessen bekamen die Tiere zwei neue Abbildungen zu sehen – eine mit fünf und eine mit drei Quadraten. Schwammen sie zu dem richtigen Bild (also bei der „blauen“ Rechenaufgabe zu den fünf Quadraten), wurden sie mit Futter belohnt. Bei der falschen Antwort gingen sie leer aus. Mit der Zeit lernten sie so, die blaue Farbe mit der Erhöhung der anfangs gezeigten Menge um eins zu assoziieren, die gelbe Zahl dagegen mit ihrer Verminderung.
Fischauge sei wachsam
Doch konnten die Fische diese Erkenntnis auch auf neue Aufgaben anwenden? Hatten sie also tatsächlich die mathematische Regel hinter den Farben verinnerlicht? „Um das zu überprüfen, hatten wir beim Training einige Berechnungen absichtlich ausgelassen“, erklärt Schlüssel. „Und zwar 3 + 1 und 3 – 1. Nach der Lernphase bekamen die Tiere diese beiden Aufgaben zum ersten Mal zu sehen. Und auch in diesen Fällen schwammen sie meistens zu den korrekten Ergebnissen.“
Das galt sogar dann, wenn sie sich nach der Aufgabe „3 + 1“ zwischen vier und fünf Objekten entscheiden mussten – also zwei Resultaten, die beide größer waren als der Ausgangswert. Auch in einer Kombination mehrerer geometrischer Formen wie Quadrat, Dreieck und Kreis hätten die Fische richtig gerechnet.
Die Forscher überraschte die Leistung der Barsche und Rochen auch deshalb, weil diese keine Großhirnrinde haben. Diese ist beim Menschen für die meisten komplexen kognitiven Aufgaben zuständig.
Rechnen: Note Zwei … Weiterschwimmen
Die Forscher fanden heraus, dass sechs Barsche und drei Rochen – von jeweils acht Tieren – Blau konsequent mit Addition und Gelb mit Subtraktion zu assoziieren. Im Durchschnitt lernten die Barsche dies nach 28 “Schulstunden” und die Stachelrochen nach 68. Die Fische schnitten bei den Aufgaben im Allgemeinen gut ab, obwohl die Addition leichter erlernt wurde als die Subtraktion und die Leistung einzelner Tiere stark variierte.
Bei den Additionsaufgaben wählten Buntbarsche in 296 von 381 Tests (78 Prozent, entspricht Note 3 plus) die richtige Antwort, während Rochen in 169 von 180 Tests (94 %, Note 1-) die richtige Antwort wählten. Bei den Subtraktionsaufgaben schnitten die Barsche mit 264 von 381 Punkten (69 %, Note 3-) ebenfalls schlechter ab als Rochen. Letztere beantworteten 161 von 180 (89 %, Note 2+) der Tests richtig lagen.
Trotz überwiegend guter Rechenleistung sei nicht bekannt, dass die beiden Fischarten ein gutes Zahlenverständnis benötige. Die Autoren vermuten vielmehr, dass numerische Fähigkeiten beiden Arten helfen könnten, einzelne Fische anhand ihres Aussehens zu erkennen, zum Beispiel durch das Zählen von Streifen oder Flecken auf dem Fischkörper.
Die Ergebnisse fügen sich in eine wachsende Zahl von Belegen ein, die darauf hinweisen, dass die kognitiven Fähigkeiten und die Empfindungsfähigkeit von Fischen überdacht werden müssen. Studienleiterin Schlüssel sieht in dem Ergebnis ihrer Arbeit zudem eine Bestätigung, dass der Mensch dazu neige, andere Spezies zu unterschätzen.
(Mit Material der Universität Bonn, Scientific Reports und afp)
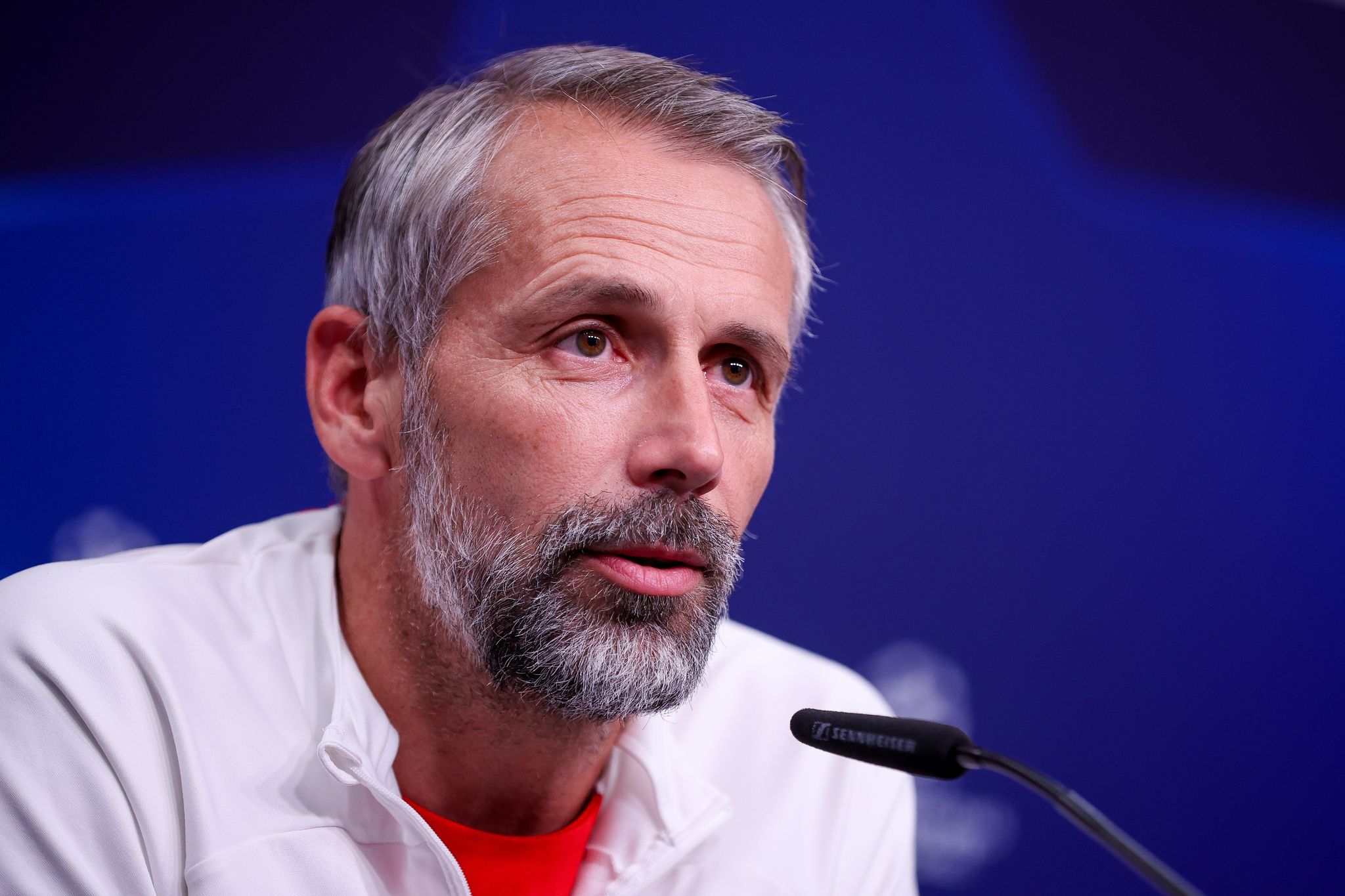
test test test 3333 test test test test test test
Aktuelle Artikel des Autors
14. Januar 2025
Infraschall aus Sicht eines Physikers: Die unhörbare Gefahr?
10. Januar 2025
Von der Steinzeit bis zum Flug ins Weltall
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.









