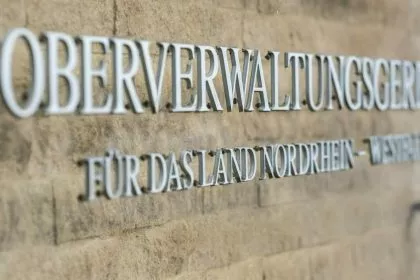„Mit herkömmlichen Mitteln“ nicht zu schlagen?
Bundes-SPD hält Verbotsverfahren gegen die AfD für eine „klare Option“
Der Vorstand fasste einen entsprechenden Beschluss, benötigt nun aber ein Urteil, das die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall bestätigt. Darüber muss das Oberverwaltungsgericht Münster in einem noch laufenden Verfahren befinden.

Der Bundesvorstand hat sich am Wochenende grundsätzlich für ein Verbotsverfahren der AfD ausgesprochen.
Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Bundesvorstand der SPD zeigt sich einem Verbotsverfahren gegen die AfD nicht abgeneigt. Voraussetzung sei, dass die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes den Erfolg eines solchen Verfahrens sicherstellen könnten. Ein Antrag auf die Prüfung einer Verfassungswidrigkeit der Partei sei „eine klare Option“, die der Verteidigung der Demokratie diene. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Sozialdemokraten am Samstag, 16. März 2024.
SPD: Die AfD ist von völkischer Ideologie durchdrungen
Ein solches Verbot sei jedoch die Ultima Ratio. „Nie jedoch darf die Demokratie tatenlos dabei zusehen, wie eine Partei sie von innen heraus zu zerstören sucht“, zitiert die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) den Bundesvorstand.
In dem Beschluss heiße es weiterhin: „Für uns steht außer Frage: Die AfD ist eine rechtsextremistische Partei, die von völkischer Ideologie durchdrungen ist und die Demokratie bedroht.“ Die Verfassungsschutzämter beobachteten die AfD nach wie vor. Es würden Erkenntnisse zusammengetragen und bewertet.
Der Verfassungsschutz hatte die AfD als Gesamtpartei bereits vor drei Jahren (März 2021) als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das Verwaltungsgericht Köln hatte dies in erster Instanz bestätigt. Die AfD wehrt sich jedoch gegen den Vorwurf und ging in die nächste Instanz.
Antragsflut an zwei Verhandlungstagen
Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster läuft noch, wie Epoch Times berichtete. In der vergangenen Woche (13./14. März) standen in Münster zwei Verhandlungstage im Terminkalender. Das erwartete Urteil blieb jedoch aus.
Unter anderem verhinderte eine wahre Antragsflut einen Richterspruch. Damit wollen die AfD-Anwälte das Gericht zwingen, seine Pflicht zu tun und zu überprüfen, ob die erhobenen Vorwürfe gegen die Partei überhaupt zutreffen. Die Beweisanträge dienten daher allein der Sachaufklärung. Die AfD argumentiert zudem, dass es nicht ausreichend sei, die Angaben des Verfassungsschutzes als wahr zu deklarieren. Sie müssten daher überprüft werden.
Das Urteil wird wegweisend für das weitere Vorgehen sein. Es sei unwahrscheinlich, dass ein Verbotsantrag in die Wege geleitet werde, wenn die Gesamtpartei nicht als gesichert rechtsextremistisch gelte, so die FAZ weiter. Einen entsprechenden Antrag könnten Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat stellen.
Ein Verbotsverfahren strebten auch die Bremer Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke an. Der Bremer Senat solle sich dafür auf Bundesebene einsetzen, hieß es am vergangenen Wochenende aus der Hansestadt.
Bereits im Januar hatte sich der bayerische Landesverband der SPD für die Prüfung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen. „Webecho Bamberg“ zitierte den Landes- und Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn mit den Worten: „Ein Parteiverbot ist aus guten Gründen im Grundgesetz verankert. Sie haben das wegen der Erfahrungen mit der Nazidiktatur getan. Die Recherchen zeigen, dass sich in dieser Partei die neuen Nazis sammeln. Deswegen prüfen wir jetzt als SPD ein solches Parteiverbot.“
Verbot Ausdruck von politischer Hilflosigkeit?
Als politische Kapitulation wertet Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ein solches Vorgehen. Die Hürden für ein Parteiverbot seien hoch. Juristisch gesehen sei es schwierig, fragwürdig wiederum aus politischem Blickwinkel, schreibt die ehemalige Bundesjustizministerin in einem Gastbeitrag der taz.
In der Geschichte gab es bisher vier Verfahren wegen eines Parteienverbots. Zwei waren erfolgreich. So verbot das Bundesverfassungsgericht 1952 die Sozialistische Reichspartei (SRP). Die Kommunistische Partei Deutschland (KPD) wurde vier Jahre später verboten. Zweimal scheiterten Versuche, die NPD zu verbieten (2003 und 2017), die 2023 in Die Heimat umbenannt wurde. Leutheusser-Schnarrenberger bezeichnet daher die Möglichkeit des Scheiterns als „ein realistisches Risiko“.
Es sei schwer nachweisbar, ob die AfD wirklich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstelle. Grundsatz- und Wahlprogramm seien im Gegensatz zur NPD „geschickt formuliert“. Eine Verfassungsfeindlichkeit müsse mithilfe von Äußerungen „hochrangiger Parteifunktionäre“ nachgewiesen werden. Dafür sei eine „gut recherchierte“ Sammlung an Beweismaterialien nötig. Ob das den Verfassungsrichtern letztlich für ein Verbot ausreiche, sei fraglich.
Leutheusser-Schnarrenberger, die aktuell Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen ist, bezeichnet das Verbot als einen Ausdruck der politischen Hilflosigkeit. Es vermittle den Eindruck, dass die AfD im politischen Diskurs die Oberhand behalten würde und „mit herkömmlichen Mitteln“ nicht zu schlagen sei. Ein Verbot wäre für die ehemalige Bundesjustizministerin keine wirksame Lösung. Die AfD wäre zwar Geschichte, doch könnten deren Köpfe eine neue Partei gründen.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.