Fiskus bittet Onlineverkäufer künftig zur Kasse
Die Bundesregierung hat ein neues Steuertransparenzgesetz verabschiedet. Der Austausch von persönlichen Daten ist europaweit möglich. Kritik des Mittelstandverbunds blieb im Finanzministerium ungehört.
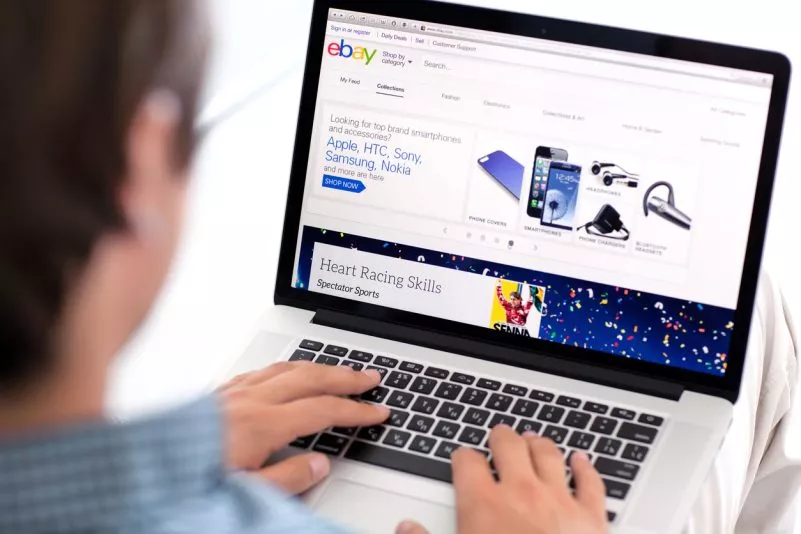
Wer bei Ebay handelt, den kann das Finanzamt künftig zur Kasse bitten.
Foto: iStock/Prykhodov
Wer künftig bei Ebay oder anderen Online-Marktplätzen Bücher, Kleidung, ausrangierte Fahrräder oder gar Autos anbietet, muss genau rechnen. Seit dem 1. Januar 2023 wirft das Finanzamt ein Auge auf ganz besonders rege Onlinehändler und bittet die möglicherweise zur Kasse. Die Grenze liegt bei 30 verkauften Artikeln oder einem Umsatz von 2.000 Euro bis Januar 2024. Wird diese sogenannte Bagatellgrenze überschritten, sind die Betreiber der virtuellen Börsen dazu verpflichtet, dem Fiskus die Namen der Verkäufer mitzuteilen. Das gilt auch, wenn die Summe bereits nach weniger verkauften Artikeln überschritten wird.
EU-Richtlinie umgesetzt
Dazu verpflichtet sie eine Regelung mit dem sperrigen Titel Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG), die der Bundestag im November 2022 verabschiedet hat. Der Bundesrat segnete es kurz vor Jahresende ab. Damit setzt die Regierung eine EU-Richtlinie vom 22. März 2021 um, schreibt unter anderem das Nachrichtportal „Business Leaders“. Neben Ebay sind unter anderem auch Amazon, Ebay-Kleinanzeigen, Hood, Yatego, Alibaba, Rakuten, Facebook-Shop oder Google-Shopping betroffen. Auch Zimmervermittler wie Airbnb unterliegen der neuen Meldepflicht.
Automatischer Informationsaustausch
Auf YouTube hat „TaxPro“ zu dem Thema ein Video veröffentlicht, in dem unter anderem erklärt wird, welche Rechte die Verkäufer haben. Ausländische Verkäufer erfasst das neue Kontrollsystem ebenfalls. Dazu gibt es nun einen automatischen Informationsaustausch von persönlichen und steuerbezogenen Daten zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU).
In der Drucksache hieß es dazu: „(…) Eine große Zahl von Personen und Unternehmen nutze digitale Plattform zur Erzielung von Einkünften. Die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung dieser Einkünfte stelle für die Finanzbehörden allerdings eine Herausforderung dar. Es bestehe Grund zu der Annahme, dass die erzielten Einkünfte vielfach gegenüber den Finanzbehörden gar nicht oder nur unvollständig erklärt würden ( …).“
Wer allerdings als Privatverkäufer auf mehreren virtuellen Handelsbörsen aktiv ist, hat einen Vorteil, denn die Freigrenzen gelten jeweils nur für die „Inanspruchnahme derselben Plattform“ (§ 4, Abs. 5, Nr. 4; PStG).
Großer Aufwand für kleine Plattformbetreiber
Die Umsetzung der Meldepflicht schießt nach Ansicht des Mittelstandsverbunds über das Ziel hinaus. Für mehr Steuertransparenz vor allem bei großen internationalen Plattformen sei zwar sinnvoll. Doch kämen auch auf Betreiber kleinerer Plattformen sehr umfangreiche Meldepflichten zu, obwohl sie wesentlich weniger Nutzer hätten.
So seien etwa die Plattformen der Verbundgruppenzentralen in der Regel nicht für alle Nutzer geöffnet, sondern akzeptieren lediglich Anschlusshäuser als registrierte Anbieter. In diesen Fällen seien aber deren Identität, Tätigkeiten und Vergütungen ohnehin bekannt und steuerlich erfasst.
Daher sorgten die zusätzlichen Meldepflichten hier „für substanziellen und in der Sache völlig überflüssigen Bürokratieaufwand“. Sie böten der Finanzverwaltung keinerlei neue Erkenntnisse. Dies habe man auch dem Bundesfinanzministerium in einer Eingabe zum Referentenentwurf mitgeteilt, heißt es auf der Internetseite des Verbunds. Die Kritik blieb jedoch ungehört.
Umfangreiche Meldepflicht
Die Meldepflicht der Plattformbetreiber umfasst eine Reihe von Informationen (§ 13): Zunächst sind Angaben zu Namen, Anschrift und Steueridentifikationsnummer des Plattformbetreibers zu tätigen. Die notwendigen Auskünfte zu den meldepflichtigen Anbietern umfassen darüber hinaus insbesondere Angaben zu Finanzkonten des Anbieters, sofern sie dem Plattformbetreiber bekannt sind: Mitgliedstaaten, in denen der Anbieter tätig ist, jegliche Gebühren, Provisionen und Steuern, die der Betreiber in jedem Quartal des Meldezeitraums einbehalten hat. Des Weiteren ist die insgesamt in jedem Quartal gezahlte oder gutgeschriebene Vergütung ebenso zu melden wie die Zahl der relevanten Tätigkeiten, für die der Verkäufer je Quartal eine Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben bekommen hat. „Damit sind die steuerlichen Meldepflichten sehr umfassend und können je nach Anzahl der meldepflichtigen Anbieter einen hohen Aufwand nach sich ziehen“, kommentiert der Mittelstandsverbund das neue Gesetz.
Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.









