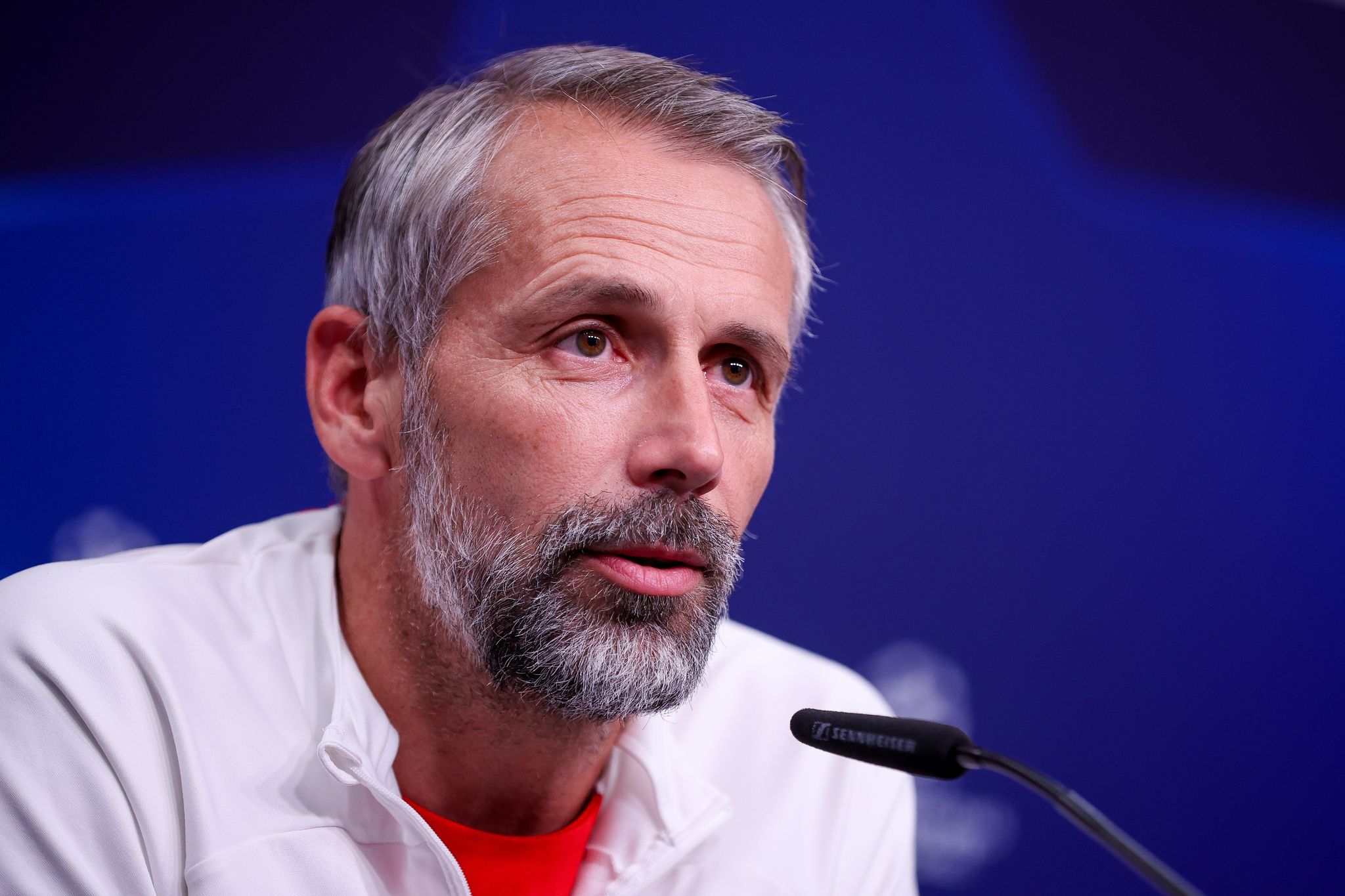Das Lesen von Büchern ist ein wichtiges Element für die geistige Entwicklung von Kindern. Aus diesem Grund plädieren Pädagogen und Bildungsforscher immer häufiger dafür, Kinder und Jugendliche zu animieren, mehr Bücher zu lesen.
Eltern sollten dabei als gutes Vorbild für ihre Kinder vorangehen. Jedoch gaben knapp ein Achtel der Erwachsenen in Deutschland in einer
Umfrage an, über eine niedrige Lese- und Schreibkompetenz zu verfügen. Solche Defizite in der Lesekompetenz sind alarmierend – nicht nur für den Zustand der Kinder, sondern auch für den Zustand des Landes.
Jeder 5. Deutsche liest kein Buch – Jeder 5. Achtklässler liest auf Grundschulniveau
Laut einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2022 lesen 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland mindestens ein Buch im Jahr. Dabei sind mit 52 Prozent die klassischen gedruckten Bücher deutlich beliebter als ihre E-Formate. Dennoch gaben auch 20 Prozent der über 2.000 Befragten an, keine Bücher zu lesen. Insgesamt aber
nimmt die Leselust der Deutschen trotz kurzzeitiger Erholung während der Corona-Pandemie seit vielen Jahren ab.
Wieso sinkt die Zahl immer weiter? Mit dieser Frage
beschäftigte sich das Marktforschungsinstitut GfK und entdeckte mehrere Gründe. Ein wesentlicher Faktor sei dabei die zu geringe Zeit in Kombination mit den immer weiter steigenden Möglichkeiten für anderweitige Freizeitaktivitäten. So sind für viele Menschen
Fernsehen oder soziale Medien beliebter. Gleichzeitig stellen auch der Bedeutungsverlust des Buchlesens in der Gesellschaft sowie geringere Konzentrationsfähigkeit und Informationsüberschüsse weitere Gründe dar.
Doch wie sieht das Leseverhalten bei deutschen Kindern und Jugendlichen aus?
Aus einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest von 2020 geht hervor, dass 31 Prozent der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren nur
selten ein Buch lesen. Weitere 14 Prozent gaben sogar an, überhaupt nicht zu lesen. Eine entsprechende Studie bei Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ergab, dass etwa ein Drittel der Teenager zu den Seltenlesern gehören und 15 Prozent zu den Nichtlesern. In den Jahren 2005 und 2006 waren
nur 7 Prozent Nichtleser unter Kindern, während bei den Jugendlichen
durchschnittlich 14 Prozent nicht lasen.
Wie wichtig das Lesen für die
Bildung der Kinder ist,
zeigt die letzte PISA-Studie aus dem Jahr 2018. Demnach lag die Lesekompetenz deutscher Schüler auf dem Niedrigniveau von 2009, womit etwa 20 Prozent der 15-Jährigen auf
Grundschulniveau lasen. Betrachtet man nur Schüler, die kein Gymnasium besuchen, lag der Anteil sogar bei 29 Prozent.
Kann Geld die Lösung sein?
Unter anderem die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr Geld für
Deutschlands Bildung. Ob das die Lösung sein kann, ist allerdings umstritten. Für den amerikanischen Journalisten Malcolm Muggeridge (1903 – 1990) war „mehr Geld“ nur ein weiterer Schritt im Teufelskreis „Bildungssystem“. Muggeridge erklärte diesen Kreislauf
in seinem Essay „Der große liberale Todeswunsch“:
„Es gab, so schien es mir, eine eingebaute Neigung in dieser liberalen Weltanschauung, das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war, zu erreichen. Nehmen wir den Fall der Bildung. Bildung war der große Hokuspokus des Fortschritts. Man ging davon aus, dass die Menschen durch Bildung immer besser, objektiver und intelligenter würden. Tatsächlich steigt aber die Zahl der Analphabeten, während immer mehr Geld für Bildung ausgegeben wird. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn am Ende nicht praktisch das gesamte Einkommen der westlichen Länder für Bildung ausgegeben wird und daraus ein Zustand des fast totalen Analphabetismus resultiert. Das ist durchaus realistisch.“
Dass er wahrscheinlich recht hat, scheinen 30 Jahre nach Muggeridge aktuelle Zahlen aus Deutschland zu belegen. So standen in Berlin im Schuljahr 2020/2021 durchschnittliche 10.400 Euro pro Schüler zur Verfügung. Spitzenreiter „in allen bundesweiten Leistungstests“ ist laut
„Stern“ Sachsen, mit einem Budget unterhalb des Durchschnitts. Hier werden lediglich 7.800 Euro pro Schüler ausgegeben.
Kritischer zu hinterfragen seien daher die schlechten Ergebnisse an sich. Der US-amerikanische Soziologe Albert Jay Nock
war der Meinung, dass das Versagen des Bildungssystems beabsichtigt sei: „Unser System wurde in dem guten Glauben gegründet, dass eine allgemeine Schulbildung die Bürger intelligenter machen würde. Dies scheint ganz offensichtlich jedoch nicht so zu sein.“ Nachdem die Schüler das mittlere Schulalter erreicht haben, könne Bildung nur noch „bestimmen, welche Intelligenz jemand hat“, so Nock. Von einer Weiterentwicklung könne nicht mehr die Rede sein.
Anforderungen sinken immer weiter
Das Bildungssystem reguliert jedoch in vielen Ländern der Welt nicht mehr auf einem hohen akademischen Niveau, sondern auf einem niedrigen. „Wenn es auch nichts zur Anhebung des allgemeinen Intelligenzniveaus beigetragen hat, so hat es doch unsere Bürger viel leichtgläubiger gemacht“, schreibt Nock. Für ihn trainiert das Bildungssystem einen Schüler darauf, „alles als wahr anzusehen, was er in Schulbüchern liest und was ihm seine Lehrer sagen“, sodass er sich schließlich einer
meinungsbestimmenden Richtung beugt.
Dies führt für Nock dazu, dass Kinder weder das Bedürfnis noch den Anreiz haben, ihren (Wissens-)Horizont durch Bücher zu erweitern – sei es von Autoren, die ähnliche Ansichten vertreten, oder von solchen, die gegensätzlicher Ansichten sind. Sein Resümee: Man habe es im Großteil schließlich mit einer Bevölkerung zu tun, die weder liest noch nachdenkt. Stattdessen tue sie einfach nur das, was Behörden und Medien ihr vorschreiben.
Ein Ausweg daraus sieht Albert Jay Nock in der Förderung des Lesens bei Kindern. Dies sollte vor allem zu Hause passieren, indem Eltern und andere Familienangehörige den Kindern gute, solide Bücher zu ausgewogenen Themen geben. Außerdem sollten Eltern für Rückfragen und Gespräche ihrer Kinder über das Gelesene offen sein und sie sanft zu höherem und besserem Denken anleiten

.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 66, vom 15. Oktober 2022.