Rundfunkbeitrag: ARD-Buhrow spricht von „Not“ - „NZZ“ von „Kritikresistenz“
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wollen noch in diesem Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht die gewünschte Anpassung des Rundfunkbeitrages erzwingen. Der Staatsvertrag droht an der fehlenden Zustimmung Sachsen-Anhalts zu scheitern.
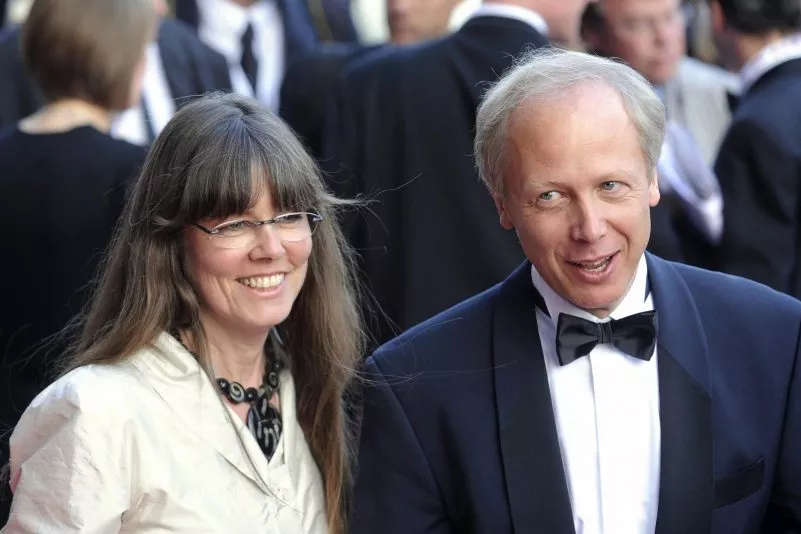
Tom Buhrow und seine Frau Sabine Stamer.
Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images
Nach den Ereignissen von Sachsen-Anhalt hatte die Abstimmung nur noch wenig Bedeutung: Dennoch hat am Mittwoch, 9. Dezember, der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Stimmen der AfD dem Rundfunkstaatsvertrag zugestimmt, der eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags von derzeit 17,50 Euro auf 18,36 Euro nach sich gezogen hätte.
Im Plenum war von der CDU Kritik an Strukturen und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems gekommen, die Abgeordneten haben die Erhöhung am Ende jedoch mitgetragen.
CDU übt im Schweriner Landtag Kritik – und stimmt am Ende doch für Erhöhung
Wie der „Nordkurier“ berichtet, hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Marc Reinhardt von einem „irren Finanzierungssystem“ von „ARD“, „ZDF“ und „Deutschlandradio“ gesprochen. Außerdem sprach er von fehlender demokratischer Legitimation der Gremien und fehlender Transparenz – etwa bezüglich der Besetzung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen (KEF).
Dass die CDU, die im Nordosten in einer Großen Koalition mit der SPD regiert, dennoch für die Erhöhung stimmte, dürfte dem Wunsch geschuldet sein, das Verhältnis zur SPD nicht zu belasten. Linkspartei und Sozialdemokraten verfügen im Landtag über eine gemeinsame rechnerische Mehrheit, sodass deren Stimmen zur Annahme ausgereicht hätten.
Zudem kommt die geplante Erhöhung zum 1.1.2021 ohnehin nicht zustande, weil Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Anfang der Woche die Abstimmung von der Tagesordnung genommen hat und die erforderliche Zustimmung des Landes damit ausbleibt.
Buhrow: Ohne höheren Rundfunkbeitrag geraten „ARD“-Landesanstalten in „Not“
Der „ARD“-Vorsitzende Tom Buhrow will unterdessen, wie er der „Deutschen Presse-Agentur“ („dpa“) gegenüber ankündigt, mittels eines Eilantrages vor dem Bundesverfassungsgericht die Beitragserhöhung noch in diesem Jahr erzwingen. Man habe, so Buhrow, „mit vielen Reformen, Kürzungen und Sparmaßnahmen im Großen und Ganzen ausgeschöpft, was man hinter den Kulissen tun kann“. Sollte die von der KEF empfohlene Anpassung nicht kommen, werde man „es im Programm deutlich sehen und hören“.
Mit Blick auf kleine Landesanstalten wie „Radio Bremen“ oder den „Saarländischen Rundfunk“ sprach Buhrow der „Welt“ zufolge sogar von „Not“ und meinte, perspektivisch würde auch der „Hessische Rundfunk“ „in besondere Verdrückung kommen“.
Steingart: „ARD“ und „ZDF“ stehen vor gleichen Herausforderungen wie private Verlage
Skeptischer sieht die Sache Publizist Gabor Steingart, der sich in seinem „Morning Briefing“ dazu äußert. Er gibt zu bedenken, dass die geplante Gebührenerhöhung von 400 Millionen Euro die Ausgaben aller politischen Parteien in Deutschland signifikant überrage.
Der „ARD“-Vorsitzende beziehe mit 395.000 Euro ein höheres Jahresgehalt als Bundeskanzlerin Angela Merkel (351.552 Euro) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (242.500 Euro). Der Oberste General der Bundeswehr, Eberhard Zorn, komme gar nur auf 170.370 Euro.
Außerdem überstiegen die Umsätze der öffentlich-rechtlichen Sender „die addierten Erlöse der Medienunternehmen Axel Springer SE, Hubert Burda Media, Gruner & Jahr, Handelsblatt Media Group, Spiegel-Gruppe und Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH“. Was Buhrow als „Not“ bezeichne, bezeichne eine Situation, die private Verlagsanstalten schon lange kannten:
„Das Geschäft muss refokussiert, die Verlagsbürokratie zurückgedrängt und die Personalkosten verschlankt werden.“
Statt diese Herausforderung anzunehmen, versuchten die Intendanten den demokratischen Prozess der Meinungsbildung in den Landtagen zu unterlaufen – der eben auch mit dem Verfehlen von Mehrheiten enden könne.
Steingart wirft den Sendeanstalten vor, „das Maß und die Mitte“ vermissen zu lassen. Die Millionenbeträge, die sie nun auf gerichtlichem Wege erzwingen wollten, würden „inmitten der Pandemie woanders gebraucht“.
Kissler („NZZ“): Framing statt Selbstkritik
In der „Neuen Zürcher Zeitung“ („NZZ“) wirft Berlin-Korrespondent Alexander Kissler den Verantwortlichen bei „ARD“ und „ZDF“ vor, auf Framing zurückzugreifen statt selbstkritisch zu hinterfragen, was man tun könne, um die Akzeptanz von Gebührenanpassungen zu erhöhen.
Stets sei von einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent die Rede gewesen, wenn über den Rundfunkbeitrag in der Öffentlichkeit gesprochen worden wäre – nicht von zusätzlichen 400 Millionen Euro oder gar von etwa acht Milliarden Euro an Jahreseinnahmen, die jetzt schon jährlich den 21 Fernsehsendern und 74 Rundfunkprogrammen zur Verfügung stünden.
Die „Gründungsväter“ des Rundfunkstaatsvertrages, so argumentierte Marietta Slomka im „heute journal“ des „ZDF“, hätten „verhindern wollen“, dass „Regierungen und Parlamente allein darüber entscheiden, wer wie viel Geld bekommt, und das gegebenenfalls als Druckmittel einsetzen“.
Wer die Einschätzung der „unabhängigen Kommission“ KEF bezüglich der angemessenen Höhe infrage stelle, so habe der Tenor der Berichterstattung nach Kisslers Einschätzung gelautet, greife die „Unabhängigkeit der Anstalten“ als solche an.
Hat Haseloff „dem Ansehen der Politik geschadet“?
Dass in den „Tagesthemen“ der „ARD“ von einer „Beitragserhöhung“ konsequent nie gesprochen wurde, sondern nur von einer „finanziellen Anpassung“, erinnere an „Snackproduzenten, wenn sie in eine größere Tüte weniger Chips stecken und von ‚verbesserter Rezeptur‘ schwärmen“. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff habe „das Ansehen der Politik geschwächt“, behauptete der „ARD“-Kommentator.
Kissler stellte diese Einschätzung infrage und hält es ebenso für denkbar, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst an Akzeptanz einbüßen, wenn sie die Erhöhung nun gerichtlich zu erzwingen versuchten:
„So wird ein Eindruck verfestigt, den manche Kritiker schon haben: dass den Anstalten jeder Weg recht ist, um sich ihr finanzielles Polster zu sichern.“
Statt „Selbstgerechtigkeit, Empörung, Kritikresistenz“ sollten die Sender besser Gründe erläutern, warum ihre finanzielle Ausstattung in einer bestimmten Höhe erforderlich sei, meint der „NZZ“-Kommentator.
(Mit Material der dpa)

Aktuelle Artikel des Autors
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.







